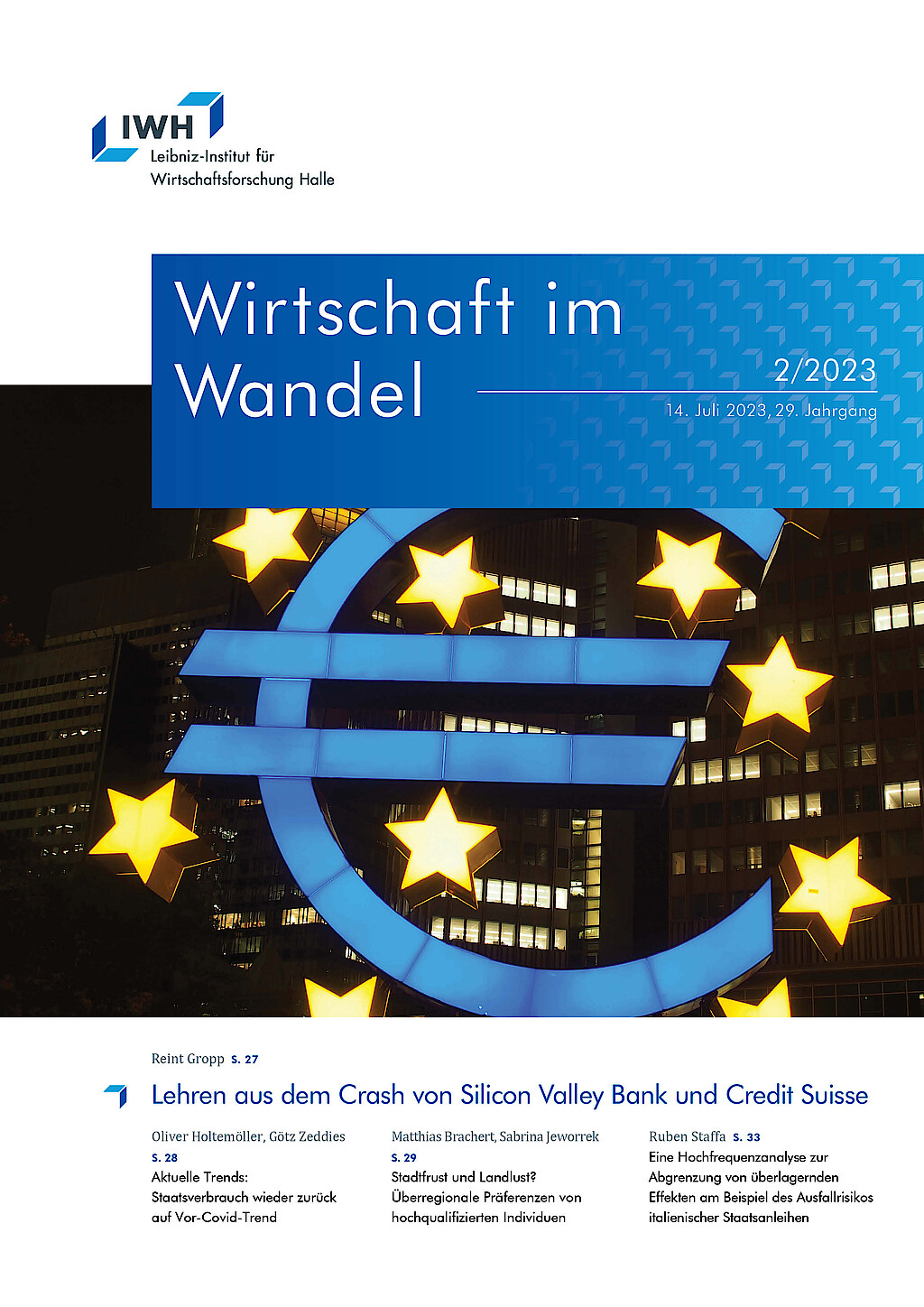
Kommentar: Lehren aus dem Crash von Silicon Valley Bank und Credit Suisse
Die „kleine“ Bankenkrise in den USA scheint vorbeizusein, und auch die Credit-Suisse-Krise ist beigelegt. Es stellt sich die Frage, was wir aus der Pleite der Silicon Valley Bank lernen können, um eine ähnliche Situation in Deutschland oder Europa zu vermeiden.
14. July 2023
Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) haben in den letzten Monaten die Leitzinsen dramatisch und sehr schnell angehoben. Die Fed hat ihren Hauptzins, die Federal Funds Rate, innerhalb von anderthalb Jahren von 0% auf 5,25% erhöht. Die EZB hat den Hauptrefinanzierungssatz für Banken seit dem Sommer 2022 von 0% auf 3,75% erhöht. Beides war eine Reaktion auf die schnell steigenden Inflationsraten, ausgelöst durch die Corona-bedingten Lieferkettenprobleme in der Industrie und die sprunghaft steigenden Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine.
Was für Auswirkungen hat ein so schneller und dramatischer Anstieg auf die Bilanzen und die Gewinne von Banken? Eine der wichtigsten Aufgaben von Banken ist die Fristentransformation. Dabei „verwandeln“ Banken kurzfristige Einlagen in langfristige Kredite und verdienen dabei eine Zinsmarge: Sie zahlen weniger Zinsen auf die kurzfristigen Einlagen, als sie von den Kreditnehmern bekommen. Wenn die Zinsen stark steigen, steigen kurzfristig auch die Zinsen, die Banken auf die Einlagen zahlen müssen. Daher verschlechtert sich die Zinsmarge, da die Kredite, die noch zu niedrigen Zinsen ausgegeben wurden, langfristig sind und noch Jahre in den Büchern der Banken verbleiben und Staatsanleihen (wie bei der Silicon Valley Bank) an Wert verlieren.
Es gibt zwei Strategien, mit dieser Situation umzugehen: Erstens können Banken dieses Risiko mit Zinsderivaten absichern. Sie lagern das Zinsrisiko also an andere Akteure im Finanzsystem aus, überwiegend an andere Banken. Die Banken versichern sich also gegenseitig. Die Risiken verschwinden zwar nicht aus dem Finanzsystem, liegen aber stärker bei denjenigen Banken, die diese Risiken besser tragen können.
Die zweite Strategie, trotz stark steigender Zinsen die Zinsmarge zu bewahren, besteht darin, den Zinsanstieg nur unvollständig an die Einleger weiterzugeben. Einlagen von Privatpersonen sind oft unelastisch, was Zinsen angeht, was Zinsen angeht: Einleger ziehen ihre Einlagen nicht ab, um bei einer anderen Bank höhere Zinsen zu bekommen. Das hat mit Transaktionskosten (Rechnungen müssen bezahlt werden, Daueraufträge sind eingerichtet) und Informationsproblemen zu tun: Privatpersonen sind über das Zinsniveau und die Zinsen, die bei anderen Banken gezahlt werden, oft schlecht informiert. In Deutschland profitieren besonders Sparkassen und Volksbanken von diesem Informationsdefizit bei Einlegern und sind daher nur relativ wenig von dem starken Zinsanstieg betroffen.
Bei gut informierten institutionellen Einlegern funktioniert diese Strategie jedoch nicht – daher auch die Probleme der Silicon Valley Bank: Ihre Einleger waren nur zu einem relativ kleinen Teil Einzelpersonen und zum großen Teil Unternehmen, insbesondere aus der High-Tech-Branche. Außerdem spielte bei der Schieflage der Silicon Valley Bank ein wichtiger lokaler Faktor eine große Rolle: Seit dem Zinsanstieg ist die Liquidität der High-Tech-Unternehmen ausgetrocknet. Noch vor einem Jahr war es für diese Unternehmen sehr leicht, Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Oft wurde dann das Geld bei Banken geparkt, um die bei Start-ups in der Anfangsphase häufig auflaufenden Verluste zu tragen. Diese Liquidität ist nicht mehr vorhanden, was dazu geführt hat, dass Tech-Unternehmen ihre Einlagen abziehen, um Defizite auszugleichen.
Die Bankenaufsicht sollte sich daher erstens darauf konzentrieren zu ermitteln, wo die Zinsrisiken nach der Absicherung tatsächlich liegen und ob diese Institutionen einen Zinsanstieg gut abfedern können. Zweitens sollte sie überprüfen, welche Finanzinstitutionen disproportional viele Einlagen von informierten Akteuren wie Anlagefonds oder großen Unternehmen haben, die erwarten, dass die Zinserhöhungen auch voll auf Einlagen weitergegeben werden und ihre Einlagen plötzlich abziehen könnten, wenn dies nicht passiert. Und drittens sollte die Aufsicht bei denjenigen Banken genauer hinschauen, die besonders in der Start-up-Szene als Liquiditätsgeber unterwegs waren.
All das sollte aber vor dem Hintergrund gesehen werden, dass gerade die europäischen Banken seit der Finanzkrise 2008/2009 besser reguliert werden: Banken müssen deutlich mehr Eigenkapital vorhalten, um etwaige Verluste besser absorbieren zu können, und sie müssen zugleich strikte Liquiditätsauflagen erfüllen. Trotzdem sollte der Fall der Credit Suisse eine Warnung sein, dass auch in Europa trotz der besseren Regulierung Banken fragil bleiben und es dann im Einzelfall sehr schnell gehen kann. Die Credit Suisse zeigt auch, wie wichtig die Wahrnehmung des Marktes ist: Hier scheint als Auslöser der Krise neben den höheren Zinsen auch der Eindruck eines schlechten Risikomanagements bei der Credit Suisse entscheidend gewesen zu sein.





