
In a nutshell
Many thousands of refugees flocked to EU member states in 2015 and 2016, especially to Germany. As has been widely and controversially discussed. The much more serious and longer-term problem of demographic change has been adeptly sidestepped, however. Although it may sound unpopular to some: immigration is vital for Germany, as there is no other way to offset demographic change. This is because the population is constantly ageing and neither the labour market, municipal infrastructure investments, nor the German pension system are currently adequately prepared.
Our Expert

President
If you have any further questions please contact me.
+49 345 7753-700 Request per E-MailAll experts, press releases, publications and events on "Demographic Change"
Europe's century-long task
The increasingly ageing population is already high on the political agenda and will pose a major challenge for the next generation. If things remain as they are, today's children will have to pay much higher pension contributions than their parents and grandparents – and receive considerably less money in return when they are old. Although demographic change is considered when adjusting pensions, this is not sufficient to prevent the scenario just described. There are certainly alternatives, however, to the existing system. For instance, pension levels at retirement age could be fixed at current levels, or even slightly higher, and the pensions of those who have already retired only be increased in line with inflation. Living standards would therefore be maintained. On the other hand, people's work-life balance must be improved, so that couples are not afraid to have children. Almost 10 years ago, the IWH determined that women only continue to work part time after having children, particularly in western Germany.
Germany's towns are also paying too little attention to demographic change and thus the future. They primarily make investments based on the current financial situation and too little on how the population will develop in future. If towns continue to do this, some will be chronically under-funded and others over-funded in 20 years' time.
Another problem is the shortage of skilled workers. In order to make it attractive for well-trained specialists to move to Germany from overseas, a targeted immigration policy is required. The projects launched to date, such as Blue Card, have not been as successful as hoped. So Germany currently remains isolated from the international pool of highly-qualified workers. A points-based system could be a promising alternative.
At the same time, Germany is facing the huge humanitarian dilemma of refugees; the enormous wave of migration since 2015 is placing considerable demands on Europe. The asylum system in Europe still has major shortcomings. A coherent European asylum policy is currently more important than ever, but the refugees have been very unevenly distributed within Europe. The IWH mooted a strategy for their equitable distribution back in 2015, which takes into account both the allocation of people and the costs.
In addition, the state must sustainably manage the integration of newcomers into our culture and labour market. This also includes improving social mobility within our society, in order to provide immigrants with good training opportunities. "Germany has been asleep for the last ten years. We have not seriously considered how we will handle our population development in 15 years' time," says Reint Gropp, President of the IWH in an interview with Mitteldeutsche Zeitung.
Despite the intake of 1.2m refugees over the past two years, Germany’s population suffers a serious decline. Especially in Eastern Germany total population shrinks. According to the OECD, about half of asylum-seekers who started off in eastern Germany in the past moved to places such as Hamburg once they secured their permit.
Whether and how this country can make economic use of the opportunities presented by immigration is currently still under discussion. Integration is a fundamental part of this debate. Due to the complexity of the issue, an interdisciplinary, scientific approach, such as that of the ‘Crises of a globalised world’ Research Group, is essential, in order to understand the reciprocal mechanisms and dynamics. For example, analyses by the IWH show that measures to cope with immigration during late 2015 triggered additional economic impetus. National and regional governments increased their budgets, while spending on housing, food, medical care and general support for refugees fuelled demand and production, especially in the construction and hospitality sectors, as well as in professional services. According to calculations by the Joint Economic Forecast Project Group, migration-related expenditure across Germany contributed 0.1 percent to the growth in gross domestic product in 2015.
Today, one in 113 people in the world is considered to be a refugee – 65 million in total. In order to resolve the complex ‘asylum’ problem, politicians need to be much better organised and ideally develop collective actions. This is the only way to achieve a solution that is as efficient as possible – and above all humanitarian.
Demographic change is profoundly affecting various social spheres, yet is still underestimated by politicians and citizens. Pensions, future investments, migration – all these things are having a direct, immediate impact on people in Germany. Which is precisely why timely, sustainable solutions are required that do not simply pay lip service to sustainability.
Publications on "Demographic Change"
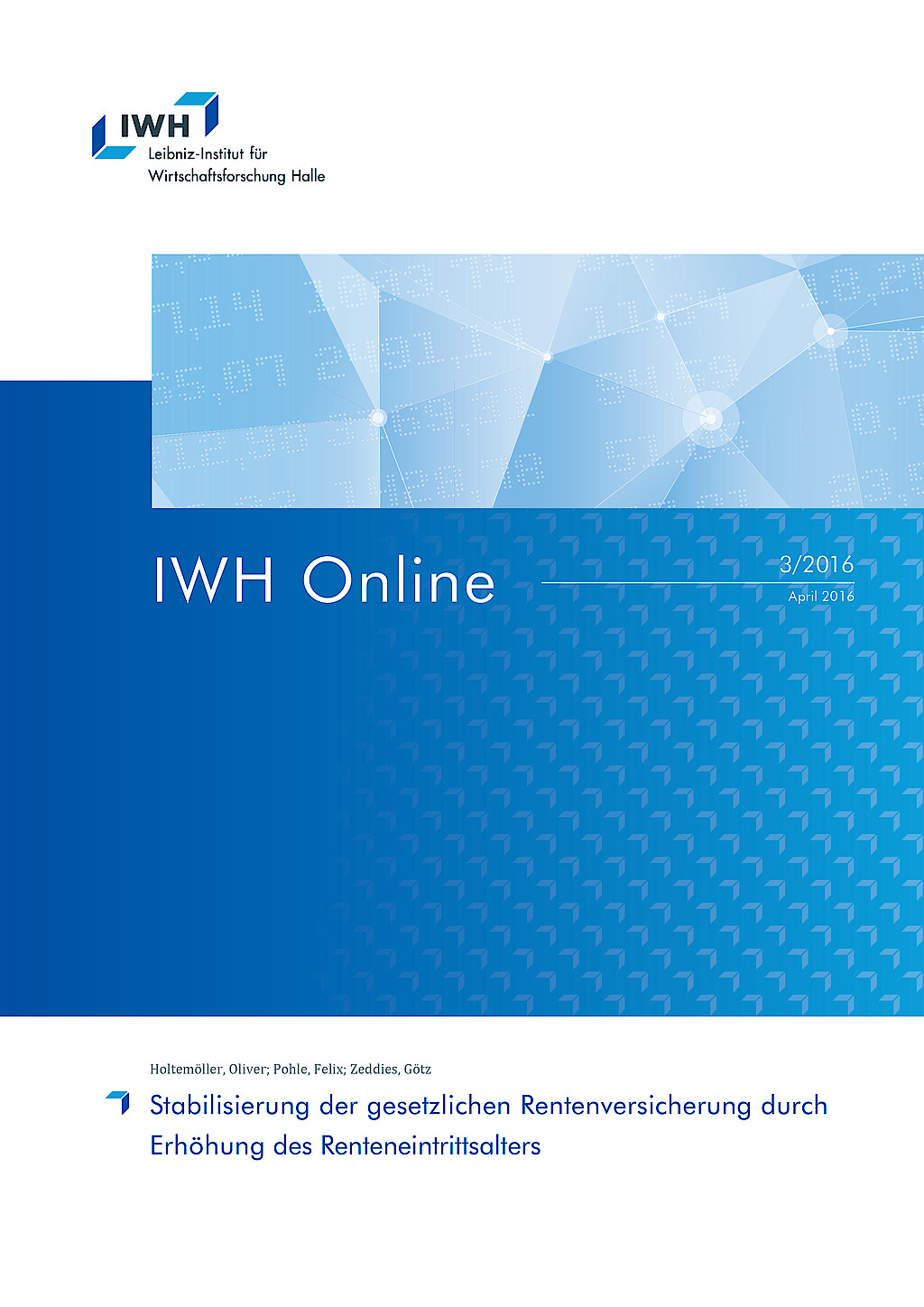
Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung durch Erhöhung des Renteneintrittsalters
in: IWH Online, No. 3, 2016
Abstract
Die deutsche Bevölkerung schrumpft. Im Jahr 2015 lebten 81,6 Millionen Menschen in Deutschland. Nach der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung werden es im Jahr 2030 noch 81,1 Millionen Personen sein, wenn man die aktuellen Geburten- und Sterberaten fortschreibt und einen jährlichen Wanderungssaldo von 200 000 Personen unterstellt. Im Jahr 2060 wird die Bevölkerung unter diesen Annahmen auf 73,3 Millionen Personen zurückgegangen sein.
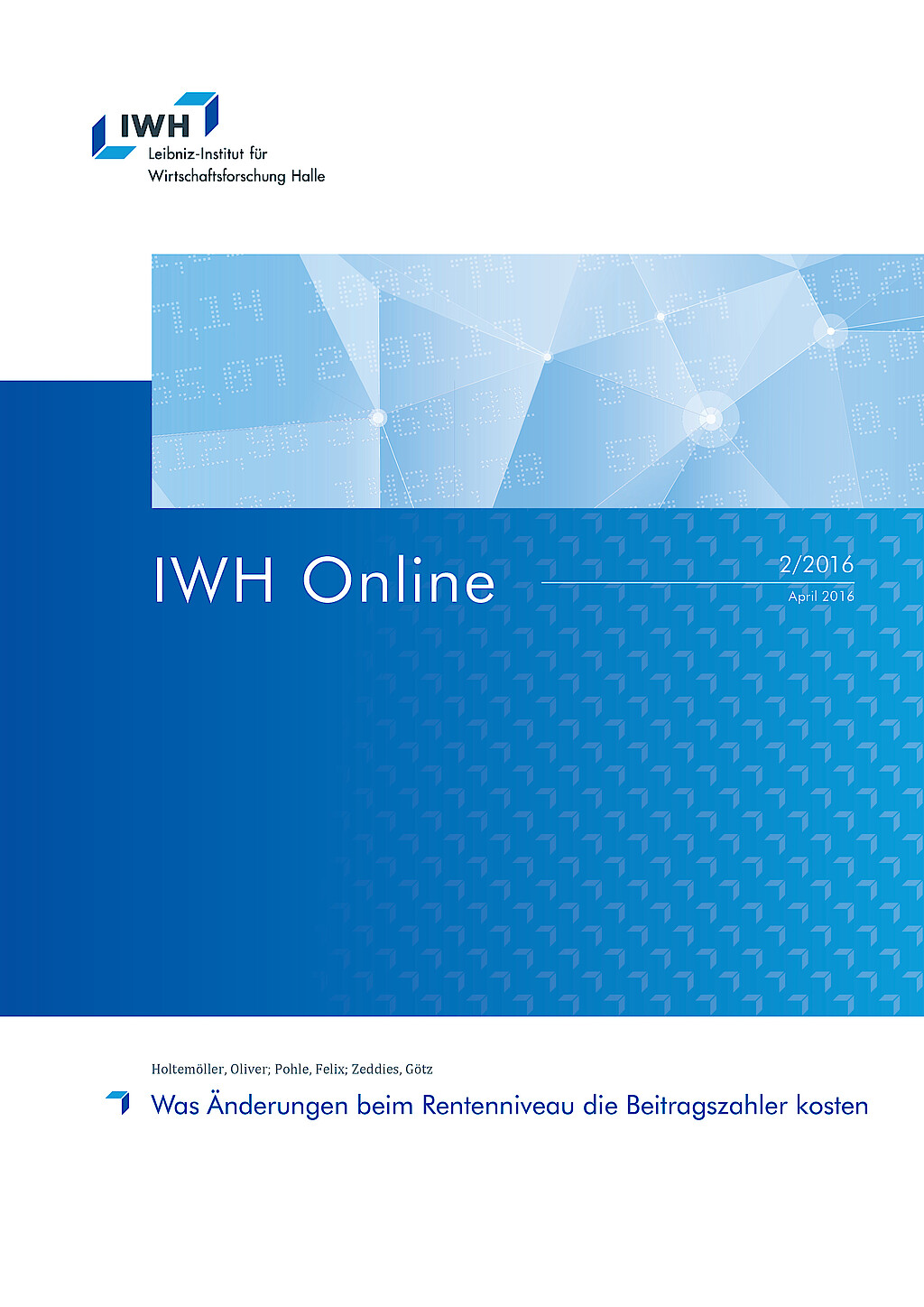
Was Änderungen beim Rentenniveau die Beitragszahler kosten
in: IWH Online, No. 2, 2016
Abstract
„Das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden“, lautet eine aktuelle Forderung des Bundeswirtschaftsministers, Sigmar Gabriel. Was würde dieser Vorschlag die Beitragszahler kosten? Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf dem Prinzip, dass die laufenden Renten aus den laufenden Beiträgen der Beschäftigten bezahlt werden. Ein solches System ist stabil, solange sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern nicht dramatisch verschlechtert. Aber genau das ist absehbar, wenn die aktuellen Geburten- und Sterberaten fortgeschrieben werden. Während im Jahr 2016 ein Beschäftigter für 0,53 Rentner aufkommt, wird ein Beschäftigter im Jahr 2030 die Leistungen für 0,68 Rentner und im Jahr 2050 für 0,83 Rentner aufbringen müssen.

Demographie und Einwanderung
in: Wirtschaft im Wandel, No. 4, 2015
Abstract
Die demographischen Effekte sind in Ostdeutschland viel drastischer als in Westdeutschland und viel gravierender auf dem Land als in der Stadt. Die Bevölkerung in Ostdeutschland schrumpft schneller als im Westen, und sie wird immer älter. Manchen Regionen droht die Entvölkerung. Nach Prognosen des Statistischen Bundesamts ist im Jahr 2030 jeder dritte Ostdeutsche 65 Jahre und älter. Der Umgang mit diesem Problem, gerade im Osten, wird in meinen Augen die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein.
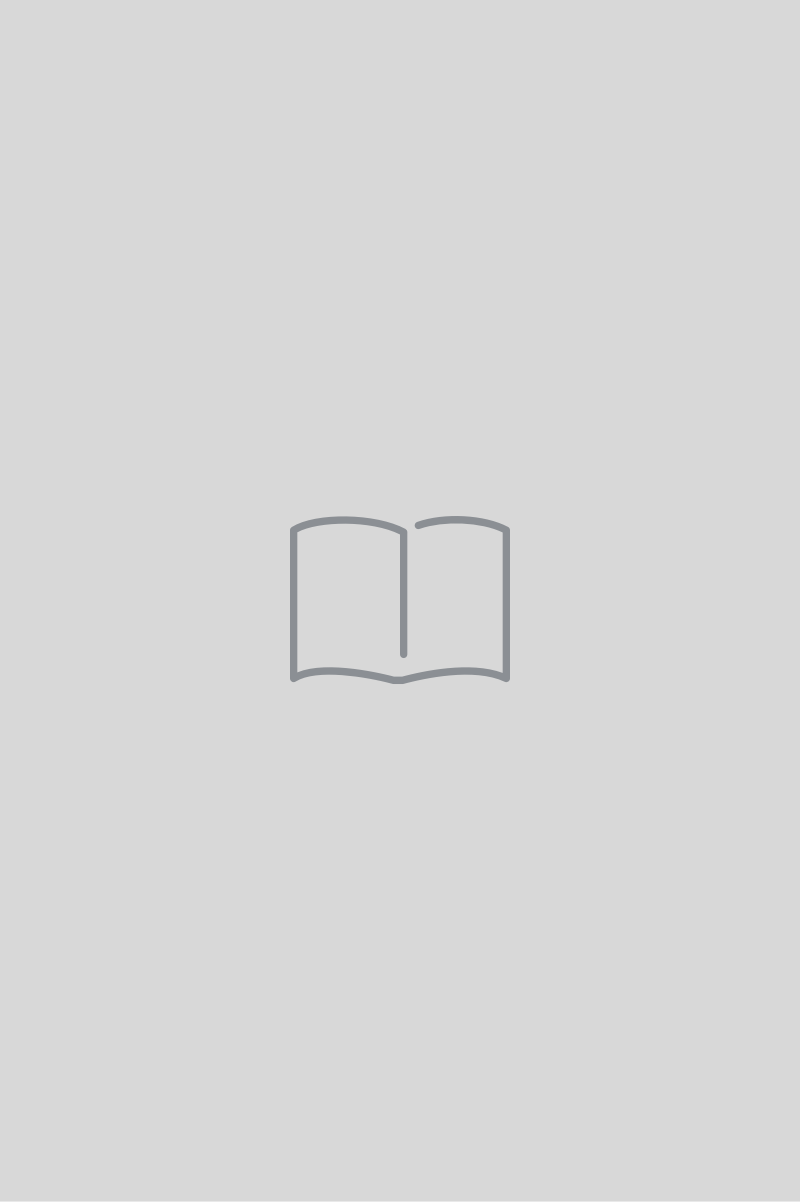
Gemeindegröße, Verwaltungsform und Effizienz der kommunalen Leistungserstellung – Das Beispiel Sachsen-Anhalt
in: External Publications, 2012
Abstract
Der Beitrag befasst sich am Beispiel Sachsen-Anhalts mit der Frage nach den Determinanten der Effizienz der kommunalen Leistungserstellung. Im Vordergrund stehen dabei der Einfluss der Gemeindegröße, der Verwaltungsform sowie von siedlungsstrukturellen, demographischen und räumlichen Faktoren. Dazu wird eine nichtparametrische Effizienzmessung (Data Envelopment Analysis bzw. der Convex-order-m-Ansatz nach Daraio und Simar) durchgeführt. Im Unterschied zu vergleichbaren Studien setzt die Untersuchung dabei auf der konsolidierten Ebene der Verwaltungsgemeinschaften und Einheitsgemeinden an, da wesentliche Kompetenzen auf der gemeinsamen Verwaltungsebene angesiedelt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass Verwaltungsverbände oder -gemeinschaften keinen signifikanten Effizienznachteil gegenüber Einheitsgemeinden aufweisen müssen. Ferner deuten die Analysen zur Skaleneffizienz darauf hin, dass die meisten sachsen-anhaltischen Gemeinden durch die Bildung von Verwaltungs-gemeinschaften 2004 eine weitgehend effiziente „Betriebsgröße“ hatten. Demogra-phische und siedlungsstrukturelle Faktoren haben außerdem einen maßgeblichen Einfluss auf die technische Effizienz der Städte und Gemeinden: Während eine höhere Bevölkerungsdichte zumindest teilweise effizienzfördernd ist, wirken ein höherer Seniorenanteil, aber auch eine positive Bevölkerungsentwicklung tendenziell eher effizienzmindernd. Die Berücksichtigung räumlicher Zusammenhänge in der Effizienzschätzung ist ein komplexes Problem, das bisher nur unzureichend gelöst wurde. Allerdings zeigten die Schätzergebnisse für Moran’s I zwar größtenteils signifikante, aber trotzdem nur geringe bis mäßige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Input- und Outputgrößen auf. Daher ist hier eine wesentliche Verzerrung der Ergebnisse nicht zu befürchten, wenn räumliche Zusammenhänge vernachlässigt werden. Auch konnte nicht nach-gewiesen werden, dass Umlandgemeinden von der Nähe zu Kernstädten in Form größerer Effizienz ihrer Leistungserstellung profitieren.
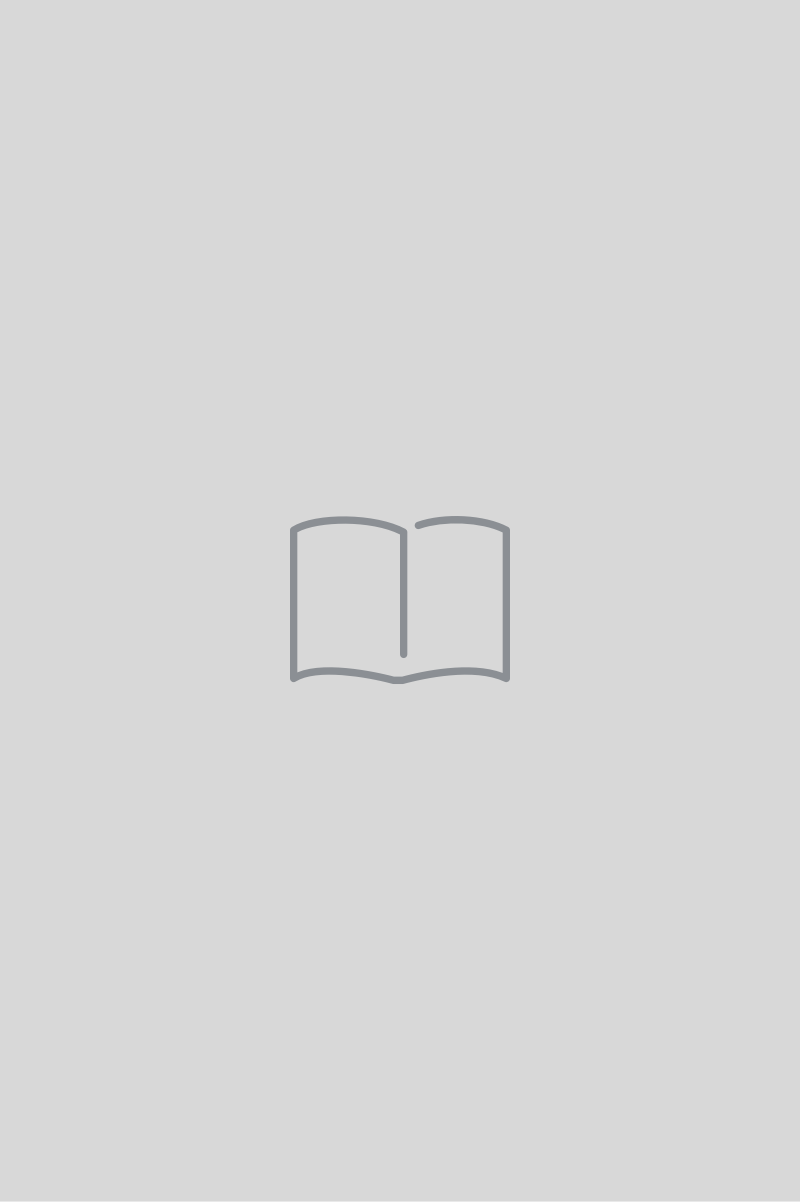
Sweden’s Policy for Guaranteeing Service Provision Based on the Example of Jämtland
in: Europa Regional, No. -1, 2012
Abstract
Die nordschwedische Provinz Jämtland zählt zu den am dünnsten besiedelten Regionen Europas und ist aufgrund ihrer ländlich‐peripheren Prägung und einer dispersen Siedlungsstruktur in besonderer Weise gefordert, adäquate Daseinsvorsorgeangebote aufrechtzuerhalten. Im Rahmen einer empirischen Studie wurden die Kinder‐ und Altenbetreuung sowie die Erwachsenenbildung exemplarisch in der Provinz Jämtland dahingehend analysiert, wie die Angebote in diesen Bereichen organisiert sind, wie sich der demografische Wandel auf das Angebot auswirkt und ob Anpassungsprozesse zu beobachten sind. Es zeigte sich, dass es zwar ein deutliches Bewusstsein für die mit dem demografischen Wandel verbundenen Probleme seitens der lokalen Akteure gibt, dass bisher jedoch noch nicht von expliziten Anpassungsprozessen gesprochen werden kann.



